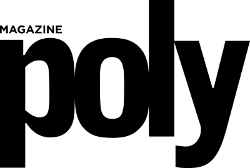Die Opéra de Dijon zeigt Cavalleria rusticana und Pagliacci
Ein Verismus des 21. Jahrhunderts: So könnte Silvia Paolis Inszenierung des klassischen Diptychons Cavalleria rusticana / Pagliacci zusammengefasst werden.
Als kurze Opern vom Beginn der 1890er Jahre, werden Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni und Pagliacci von Ruggero Leoncavallo sehr oft gemeinsam gezeigt, am gleichen Abend. In der Tat teilen sie, neben einer echten klanglichen Verwandtschaft, gemeinsame politische Sorgen. Diese veristischen Werke haben tatsächlich die Ambition die unverblümte Wirklichkeit auf der Bühne zu zeigen. Die beiden Komponisten hatten so „den Willen, das Volk abzubilden, das auch das Publikum der Oper war! Das erscheint uns heute kurios, aber im 19. Jahrhundert handelte es sich um eine sehr populäre Unterhaltung“, unterstreicht Silvia Paoli. Sie hat die Aktion heute in einen Rahmen versetzt, der beiden Opern gemeinsam ist und der an einen Platz erinnert, der von Gittern umzogen und von Abfällen bedeckt ist, irgendwo in Süditalien, weit entfernt von der Postkartenansicht. Dieses brutalistische Universum aus mit Graffiti besprühtem Beton, mit dem zwischen den Platten wachsendem Moos als einziger Pflanze, lässt mehr an Gomorra denken, als jeder Avatar von Ein Herz und eine Krone…
Indem sie zwei Intrigen verbindet, lässt sie den Zuschauer in die Welt von Außenseitern eintauchen – Junkies, Obdachlose, Kleinganoven und Alkoholiker – beginnend mit Cavalleria rusticana: „Inmitten dieses Bühnenbildes ist eine Frau, die von Giusi Merli verkörpert wird, einer wunderbaren Schauspielerin. Sie ist eine alte arme Frau, die eine starke symbolische Kraft konzentriert. Sie stellt für mich eine „Penner-Madonna“ dar. Sie ist in der Geschichte diejenige, die eine Form von Spiritualität bewahrt: Der Akt des Teilens, die Großzügigkeit, das Dasein für die anderen… Sie ist das Symbol für das, was echt und authentisch geblieben ist“, fasst die Regisseurin zusammen. Am Anfang von Pagliacci, stirbt diese Figur – die in den Originalversionen des 19. Jahrhunderts nicht existierte – auf der Straße: „Man gleitet in die Hoffnungslosigkeit ab, insbesondere durch den Femizid. Niemand hilft dieser Frau, alle schauen zu. Es ist immer die gleiche Geschichte. Jeder von uns ist der Zuschauer dieser Misere.“ Da sie essentielle Themen anspricht – vom Verhältnis der patriarchalischen Domination bis zum Platz der Religion heute – verströmt diese Produktion eine sehr subtile Ästhetik, die auf Gemälde von Giotto und Masaccio verweist, Einflüsse, zu denen sie steht: „Es musste eine sehr präzise Arbeit zu den Farben geliefert werden, insbesondere die Kleidung. Die Kostüme sind moderne Kleidungsstücke, aber sie entsprechen den genauen Farbtönen der Gemälde.“
Im Auditorium der Opéra de Dijon vom 5. bis 9. November
opera-dijon.fr