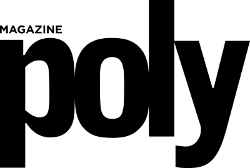Im Museum Tinguely präsentiert Julian Charrière Midnight Zone
In Midnight Zone, einer Ausstellung, die sich auf Wasser konzentriert, befasst sich Julian Charrière mit Scharfsinn und Poesie mit dem Zustand des Planeten.
Eine winzige und zerbrechliche dunkle Silhouette hebt sich vor dem strahlenden Weiß eines riesigen Eisberges ab, der auf dem Arktischen Ozean treibt: Bei näherer Betrachtung der drei zutiefst malerischen Aufnahmen (die an einige Gemälde von Caspar David Friedrich erinnern) aus The Blue Fossil Entropic Stories (2013), stellt der Besucher fest, dass die kleine Figur – der Künstler selbst – das Eis mit einem Gasbrenner zum Schmelzen bringt. Mit dieser Reihe weist Julian Charrière auf die Auswirkungen der menschlichen Aktivitäten hin, zeigt die Konsequenzen der individuellen Handlungen auf das Ökosystem und die Absurdität unsers Verhaltens. In der Arbeit des französisch-schweizerischen Künstlers ist das Wissen um die Art und Weise wie der Mensch die Welt bewohnt (und umgekehrt) in der Tat zentral. Das ist die Aussage von Midnight Zone, dem Titel der Ausstellung – der auf die Bathypelagial-Zone verweist (zwischen 1000 und 4000 Metern Tiefe, wo das Sonnenlicht verschwindet) – und eines Videos von 2024, das das potentielle Erbeuten in der Bruchzone von Clipperton hinterfragt: Reich an polymetallischen Knollen ist sie empfindlich und bewohnt von einer bizarren und faszinierenden Flora und Fauna. Der Künstler stellt die miteinhergehenden Risiken einer kapitalistischen Ausbeutung der Tiefseegräben in den Fokus, indem er in einen traumhaften Wasserraum mit metaphysischen Anklängen eintaucht.
Im Zeichen des Wassers, „die Voraussetzung allen Lebens, die erste Außenhaut der Erde, das Medium unseres Werdens“, für Julian Charrière, der unermüdlich den Planeten durchstreift (auf der Erde an so emblematischen Orten wie Semipalatinsk wo die Sowjets Atomwaffentest machten, oder unter Wasser), ist der Rundgang vielfältig. Er entführt uns in die vergessenen Küchen eines amerikanischen Flugzeugträgers, der in der Lagune des Bikini-Atolls versank (Silent World, Saratoga, 2018), womit er Kernwaffentests anprangert, oder zu verschmutzten Meeresböden. The Gods Must Be Crazy (2019), Installation aus 40 Bildschirmen, zeigt so Bilder, auf denen man eine abstoßende Archäologie entdeckt, die Abfälle, die von unseren Gesellschaften produziert werden: Coca-Cola-Dosen, Plastikstücke ohne bestimmbaren Nutzen, etc. Poetischer sind die mystischen Aufnahmen von nackten Apnoetauchern in mexikanischen Gewässern (Where Waters Meet, 2019), gespenstisch schwebende Erscheinungen, die das illustrieren, was Romain Rolland als das „ozeanische Gefühl“ bezeichnete, jenes eins zu sein mit dem Universum. Ebenso lyrisch präsentiert sich Albedo (2025), das in arktischen Gewässern unter dem Eis aufgenommen wurde und das an die Decke des Museums projiziert wird, wie ein Schrei von intensiver Schönheit um uns vor dem Schmelzen des Packeises zu warnen.
Im Museum Tinguely (Basel) bis 2. November
tinguely.ch – julian-charriere.net